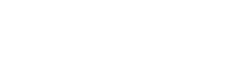Es ist nicht lange her, dass auf Berlins Straßen 240.000 Menschen demonstrierten: Wir sind unteilbar. Die Resonanz traf die Veranstalter unerwartet, das kleine Wort mit der Raute davor traf einen Nerv. Aber welchen?
Das Kernanliegen des Bündnisses lautete: »Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden.« Es war die bündige Antwort auf sich zuspitzende Entwicklungen davor. Einige der sichtbarsten Momente seien genannt: Erstens die zutiefst verstörende Erfahrung, dass jene, die in Europa das Sagen haben, Menschen auf der Flucht im Meer eher ertrinken lassen, als ihre bornierten nationalen Interessen zurückzustellen. Und zweitens die Tatsache, dass jene, die bereit waren zu retten, nicht nur daran gehindert, sondern auch kriminalisiert wurden. Drittens: die verängstigenden Bilder rechter Aufmärsche und die Gewalt auf den Straßen.
Chemnitz war dabei nur der sichtbarste Ausdruck einer länger schon laufenden Verschiebung in der Parteienlandschaft, die mit einem wachsenden Rechtspopulismus einhergeht, der verschärften Konkurrenz und Ausgrenzung, der Verrohung der Kommunikationskultur. Eine hilflose Reaktion darauf zeigte sich in der Debatte im linksliberalen Spektrum, die in einer lähmenden Schleife mündete: Man habe sich zu sehr auf die Themen Rassismus und Sexismus – man kann es Nebenwidersprüche nennen – konzentriert. Das Soziale sei vernachlässigt, die Arbeiter alleingelassen worden. Menschen, die sich bislang für soziale und globale gleiche Rechte einzusetzen glaubten, wurden als Kosmopoliten eher diffamiert als nur bezeichnet; Zerrbilder von Biolimonadetrinkern, die sich den Kurztrip nach London und eine »bessere Moral« leisten könnten, machten die Runde.
Das Ganze ist inzwischen in einem Konflikt kulminiert, der die Komplexität historisch gewachsener nationalstaatlicher Gebilde reduzierte auf ein Für oder Wider offener Grenzen. Zur Ermüdung vieler stiller Beobachter wurde herauf und herunter gestritten – während die Rechten nur immer stärker zu werden schienen.
Es war für viele ein Befreiungsschlag, dass sich mit #unteilbar plötzlich ein Raum öffnete, der vermeintliche Widersprüche – Solidarität mit Geflüchteten, soziale Forderungen hierzulande, weltgesellschaftliche Veränderung – unter einem Dach auszusöhnen vermochte. Das war nötig. Dringend.
Im Nachgang scheint ein etwas genauerer Blick auf das kleine Wort mit der Raute davor nötig: Was kommt nach dem Herbst der Solidarität? Und wie lässt sich das, was da als »neue« Gemeinsamkeit massenhaft auf die Straße drängte – von den streikenden Ryanair-KollegInnen bis zu Seebrücke-AktivistInnen, von ParteianhängerInnen bis zur Bewegungslinken, von ÜberwachungskritikerInnen bis zu Kulturschaffenden – auf einen Begriff bringen, der in die Zukunft trägt?
Es war eine der herausragenden Merkmale des Bündnisaufrufs zu dieser Demonstration, soziale Ungleichheit zu thematisieren – im Aufruf, auf der Kundgebung. Aber abermals, so schien es, standen Werte wie Solidarität, Pluralität, Toleranz – die offene Gesellschaft – gleichsam wie bloß hinzuaddiert neben der sozialen Frage auf der Bühne. Doch: Etwas, das nebeneinander steht, kann auch gegeneinander gestellt werden. Wie rauskommen aus diesem Dilemma?
Unsere gelebte Erfahrung ist, wenn man ehrlich ist: Wir sind teilbar. Jeden Tag. Wir sind teilbar in die vielen, die arbeiten müssen, um zu leben, und die wenigen, die uns arbeiten lassen, weil sie die Mittel dazu besitzen: Fabriken, Bürogebäude, Maschinen, Rohstoffe, kurz: Kapital. Und zwar ein Kapital, welches – abermals – zu Hause und weltweit in Konkurrenz steht um ständiges Wachstum, nicht um des Wohlstands, sondern um des weiteren Wachstums willen. Wir sind als Einzelne Teil dieser Verhältnisse, als solche erpressbar werden wir gegeneinander ausgespielt. Und wir lassen uns ja auch immer noch viel zu oft gegeneinander ausspielen: global, lokal und regional; um Jobs, Karriere, Wohnung, Einkommen; um Einfluss, saubere Umwelt, Lebenschancen.
Karl Marx hat anschaulich erklärt, wie uns »Kapitalismusbewohnern« diese strukturelle Konkurrenz als eine quasi natürliche erscheint; wie sie sogar unter der Hand umgedeutet wird in eine Errungenschaft individueller Freiheit, wo angeblich jeder seines Glückes Schmied sein soll – wer versagt, ist entweder selber schuld. Oder sucht die Schuld dafür bei anderen: bei den Flüchtenden, den Armen, den Schwachen, den Reichen, den Frauen, den Männern, den Eliten, denen da oben, denen Nebenan.
Die Spaltungslinien, die dem Kapitalismus innewohnen, sind in einem komplexen Geflecht miteinander verwoben. Der Gewerkschafter Hans-Jürgen Urban schrieb einmal, »wenn eine noch so ambitionierte Wertepolitik nicht an die systemischen Zwänge des Gegenwartskapitalismus rückgekoppelt wird, bleibt sie schnell im Appellativen hängen«.
Das dürfen wir auch nach der Demonstration von Berlin und den vielen anderen Kundgebungen der Solidarität, des Humanismus und der globalen Gerechtigkeit nicht vergessen: Wenn wir wirklich #unteilbar sein wollen, müssen wir – anknüpfend an den 13. Oktober – noch einige Schritte gehen.
Erschienen in: OXI, Wirtschaft anders denken, 2. November 2018, S. 2