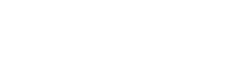Wer im Sommer 2019 in Berlin der mietenpolitischen Auseinandersetzung folgte, wurde Zeuge einer ideologischen Schlammschlacht: Die Berliner Senatorin für Stadtentwicklung, Katrin Lompscher, hatte als Reaktion auf die gestiegenen Mieten in der Stadt einen Entwurf für ein „Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin“ vorgelegt.
Er sah unter anderem vor, die Mieten für fünf Jahre einzufrieren, eine Mietobergrenze einzuführen und Mieten möglicherweise sogar abzusenken. Explizit ausgenommen wurden seit 2014 fertiggestellte Immobilien, und weitere Sonderregelungen sollten „unbillige Härten“ für Vermieter vermeiden. Noch bevor jedoch irgendein Gesetz beschlossen war, wusste manch ein Vertreter der Immobilienbranche, dass damit die „linke Baubrigade“[1]die Hauptstadt auf direktem Weg zurück in die DDR führen würde. Diese schrille Polemik übertönt die Debatte, die eigentlich geführt werden müsste: eine Grundsatzdebatte über das Eigentum an Wohnraum.
Als Gründe für steigende Mieten werden meistens das Bevölkerungswachstum in den Städten und zu wenig Neubau genannt. Diese Diagnose ist nicht falsch. Stadtsoziologen haben in den letzten Jahren allerdings rauf und runter analysiert, dass die Gründe tiefer liegen: So wurde etwa Ende der 1980er Jahre die Gemeinnützigkeit für den Wohnungssektor abgeschafft. Das heißt, für etwa 1800 Wohnungsunternehmen mit fast vier Mio. Wohnungen wurden die bis dahin geltenden Gewinnbeschränkungen aufgehoben. Darüber hinaus privatisierten Bund, Länder und Kommunen seit den 1990er Jahren über zwei Mio. Wohnungen. Der soziale Wohnungsbau wurde schrittweise abgebaut: „Allein zwischen 1992 und 2012 reduzierte sich die Anzahl der Mietpreis- und Belegungsbindungen im Sozialen Wohnungsbau von 3,6 Mio. auf unter 1,5 Mio. Wohnungen.“[2] Denn nach Ablauf der Förderprogramme wurden die ehemaligen Sozialwohnungen dem freien Markt überlassen. So hat man politische Gestaltungsmöglichkeiten aufgegeben. Der Markt sollte es von nun an regeln.
Dieser Markt, der der reinen Lehre zufolge immer dort ein Angebot schafft, wo es eine Nachfrage gibt, bringt allerdings bevorzugt Eigentumswohnungen statt Mietwohnungen hervor. 2015 wurden weniger als 50 000 der insgesamt 217 000 fertiggestellten Wohnungen als Mietwohnungen errichtet:[3] „Gerade weil das Geschäft mit den Mietsteigerungen so attraktiv ist, wird zu wenig neu gebaut“, so der Stadtsoziologe Andrej Holm. Investoren bauen nur dann, wenn sie einen Gewinn erwarten. Daher sind auch die Mietpreise in den Neubauten alles andere als günstig: In den Innenstädten der wachsenden Großstädte werden Neubauwohnungen deutlich teurer angeboten als Wohnungen in älteren Gebäuden. Nicht nur das: Im Neubau steigt die Miete auch deutlich stärker als in Altbeständen. Die so dringend benötigten Wohnungen für Haushalte mit geringen Einkommen kann der Neubau demnach nicht bieten – zumindest nicht unter privatwirtschaftlichen Bedingungen. Dabei fehlen allein für Berlins rund 350 000 armutsgefährdete Haushalte rund 120 000 Wohnungen.[4] Die Empfehlung der Mietendeckel-Gegner – mehr staatliche Anreize für privates Bauen – löst also gerade das Problem nicht, dass günstige Wohnungen massenhaft fehlen.
Armut ist keine Naturnotwendigkeit
Dass es überhaupt so viele so geringe Einkommen gibt, wird in der stadtpolitischen Debatte hingenommen, als würde es einer Naturnotwendigkeit entspringen, ähnlich dem Wetter: Armut gibt es nun mal. Tatsächlich ist die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen fester Bestandteil einer marktwirtschaftlichen Ökonomie. Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich jedoch in den letzten Jahrzehnten durch die (politisch gewollte) Schaffung eines Niedriglohnsektors noch verschärft.
Um die heutige Ungleichverteilung des Wohnraumes zu verstehen, müssen wir zudem zwei weitere Prozesse mitbedenken: Erstens ist, wie die Stadtforscherin Susanne Heeg aufgezeigt hat, die Entwicklung des deutschen Wohnungsmarktes in den globalen Wandel eingebettet, der sich in den letzten drei Jahrzehnten vollzogen hat. Dessen Kennzeichen sind unter anderem die Internationalisierung und Liberalisierung der Finanzmärkte. Gerade Immobilien, insbesondere in Deutschland, haben sich vor diesem Hintergrund in begehrte Renditeobjekte verwandelt. Sie gelten momentan nicht nur als lukrativste, sondern auch als sicherste Anlageform. Mieten unterliegen also heute immer höheren Renditeansprüchen seitens der Eigentümer der jeweiligen Immobilien.
Zweitens sind wir heute damit konfrontiert, was Heeg „finanzwirtschaftliche Selbstregierung der Individuen“[5] nennt: Durch den Abbau des Sozialstaats sind die Menschen zunehmend darauf angewiesen, sich selbst gegen fundamentale „Lebensrisiken“ abzusichern. So werden die Individuen in den Prozess der Finanzialisierung verstrickt. Ein besonders folgenreiches Beispiel dieser Privatisierung der Daseinsvorsorge ist die Abkehr von der umlagefinanzierten Rente und die Hinwendung zur privaten Vorsorge. Beiträge für die zunehmend notwendige private Rentenvorsorge fließen entweder in Pensionsfonds, die wiederum als Kapitalsammelstellen unter anderem in Immobilien investieren. Mietsteigerungen sollen dann die Rendite der Anleger optimieren. Oder aber die „sich selbst regierenden“ Individuen kaufen – sofern mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet – zur privaten Rentenvorsorge eine Eigentumswohnung. So vervielfacht sich die Anzahl jener, die die Miete – das Einkommen anderer – als Mittel dazu nutzen, ihr eingesetztes Kapital zu verwerten und ihre eigene Vorsorge zu sichern. Die gegensätzlichen Interessen prallen frontal aufeinander, insbesondere dann, wenn – wie derzeit zu beobachten – die Einkommensentwicklung nicht mit der Mietentwicklung Schritt hält.
Die Unterwerfung der kommunalen Daseinsvorsorge unter die Marktlogik hat im Verbund mit vielen weiteren neoliberalen Entwicklungen der letzten Jahre zu einer stärkeren Spaltung der Gesellschaft geführt, in der jeder gezwungen wird, nur seinen eigenen Vorteil zu suchen. Der naive Glaube der herrschenden Ökonomie, wonach der Eigennutz, der Sondervorteil der Individuen und ihre Privatinteressen, die einzige Macht sind, die sie zusammenhält und zugleich zur besten aller möglichen Welten führt, wurde schon von Marx ironisch paraphrasiert: „Und eben weil so jeder nur für sich und keiner für den andren kehrt, vollbringen alle, infolge einer prästabilierten Harmonie der Dinge oder unter den Auspizien einer allpfiffigen Vorsehung, nur das Werk ihres wechselseitigen Vorteils, des Gemeinnutzens, des Gesamtinteresses.“[6]
Kein Recht auf größtmöglichen Profit
Nun hat das Bundesverfassungsgericht – sozialistischer Umtriebe unverdächtig – erst jüngst das Verhältnis von Privat- und Gesamtinteresse zurechtgerückt; und zwar in einem Urteil zur (weitgehend wirkungslosen) Mietpreisbremse. Dort betonte das Gericht, was viele in der aufgeregten Debatte derzeit vergessen: Eigentum verpflichtet. Zwar legt das Grundgesetz in Artikel 14(1) fest, dass Eigentum gewährleistet wird. Es sagt jedoch zugleich, dass Inhalt und Schranken durch Gesetze bestimmt werden. Und Absatz 2 ergänzt, dass der Gebrauch des Eigentums dem „Wohle der Allgemeinheit dienen soll“. Das „Wohl der Allgemeinheit“ ist allerdings ein dehnbarer Begriff, nicht objektiv bestimmbar und daher immer Ergebnis gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Im Falle der Mietpreisbremse urteilte das Gericht eindeutig: „Es liegt im öffentlichen Interesse, der Verdrängung wirtschaftlich weniger leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen aus stark nachgefragten Stadtteilen entgegenzuwirken. Die Regulierung der Miethöhe ist auch im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, dieses Ziel zu erreichen.“[7]
Darüber hinaus stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Vermieter auf dem „sozialpolitisch umstrittenen Gebiet des Mietrechts“ mit häufigen Gesetzesänderungen rechnen müssen. Sie könnten daher nicht darauf vertrauen, „mit der Wohnung höchstmögliche Mieteinkünfte“ zu erzielen. Das sei durch die Eigentumsgarantie nicht geschützt. Mit anderen Worten: Die Verfassung schützt zwar das Recht auf Eigentum, nicht aber das Recht auf größtmöglichen Profit. Die Spekulation darauf, dass sich mit den Mieten anderer das eigene Kapital vermehre, ist daher den gleichen Risiken ausgesetzt wie die Anlage in Aktien oder Anleihen.
Der Umstand, dass das individuelle Eigentum von vorneherein gesetzt ist und – wie im Fall des Urteils zur Mietpreisbremse – erst im Nachhinein Einschränkungen erfährt, ist längst nicht so selbstverständlich, wie wir es heute hinnehmen. Vielmehr ist das heutige Primat des Privateigentums eine historische Besonderheit.[8] Und es ist vor allem das „Privateigentum an Produktionsmitteln“, um mit Marx zu sprechen, das der modernen Marktgesellschaft seinen Stempel aufdrückt und dessen Auswirkungen nun auch auf dem Wohnungsmarkt zu besichtigen sind.
Konzentriert ist dieses „Privateigentum an Produktionsmitteln“ in nur wenigen Händen. Die Vermögensbefragung der Deutschen Bundesbank für 2017 ergab, dass nur zehn Prozent der privaten Haushalte in Deutschland Betriebsvermögen besitzen, darunter auch sehr kleines. Das heißt, größeres Betriebsvermögen ist auf noch erheblich weniger Haushalte konzentriert: Betriebsvermögen, so die Bundesbank, „ist ebenso wie Aktienvermögen bei den vermögenden Haushalten im oberen Teil der Verteilung konzentriert und eine der am ungleichsten verteilten Vermögensarten“.[9] In seltener Klarheit verwies auch der Internationale Währungsfonds (IWF) im Juli 2019 auf den gleichen Sachverhalt: „Deutschland ist eines der Länder mit der höchsten Vermögens- und Einkommensungleichheit der Welt“ – Tendenz steigend. Verantwortlich für diese Entwicklung seien die großen Familienunternehmen, da sich dort der Reichtum „in den Händen einiger weniger“ konzentriere.[10]
So bestimmen die Eigentümer des Betriebsvermögens darüber, wozu sie ihre Produktionsmittel einsetzen, welche Güter und Dienstleistungen damit hergestellt werden, wie viel davon, aus welchen Vorprodukten und Rohstoffen sie bestehen, zu welchen Umwelt- und Arbeitsbedingungen sie produziert werden. Die so produzierten Güter schließlich werden auf einem anonymen Markt zum Verkauf angeboten, allerdings einzig mit dem Zweck, dass sich das dafür eingesetzte Kapital vermehre. Nichts anderes macht ein Immobilienkonzern, wenn er Häuser saniert und sie verkauft oder aber wenn er Häuser kauft, saniert und über die Vermietungen Erlöse erzielt.
Die Befriedigung von Bedürfnissen ist in einer marktwirtschaftlichen Ökonomie daher merkwürdig auf den Kopf gestellt. Sie wird als Mittel genutzt, um aus vorgeschossenem Kapital mehr Kapital zu machen – allerdings werden dann auch nur diejenigen Bedürfnisse befriedigt, bei denen dies profitabel ist. Kapital kann zu diesem Zweck in Fabriken, Abfall, Kohleminen, Gaststätten, Gift, Computer, Software und Autos genauso investiert werden wie in Häuser oder Wohnungen. Marx nannte das die Gleichgültigkeit des Tauschwerts gegenüber dem Gebrauchswert. Je nach politischen Rahmenbedingungen führt das zu einer mehr oder weniger starken Konzentration des Kapitals in wenigen Händen. Natürlich entstehen auf diese Weise auch neue Wohnungen und werden auch Wohnungen zur Miete angeboten. Aber eben nur solche, die sich für das Kapital rentieren; die Miete dient nicht allein dem Erhalt der Substanz oder der Modernisierung, sondern der Rendite des eingesetzten Kapitals.
Weitreichende Handlungsspielräume im Grundgesetz
Dass Haushalte mit geringem Einkommen dabei leer ausgehen, wissen auch die Vertreter der Immobilienwirtschaft. Hier aber, so die propagierte Lösung, müsse der Staat einspringen: entweder indem er die „Einkommensschwachen“ mit Wohngeld unterstützt oder indem der private Wohnungsbau staatlich gefördert wird, sofern er eine bestimmte Mindestanzahl preisgebundener Wohnungen anbietet. Das heißt: Die Vermehrung privaten Kapitals soll mit Steuergeldern gefördert werden – eine Umverteilung von öffentlich zu privat, die die soziale Ungleichheit abermals [11] Zugleich wird damit eingestanden, dass es der Markt eben doch nicht allein richten kann, genauer: dass er nur in der Lage ist, die zahlungsfähigen Bedürfnisse, nicht aber die tatsächlichen Bedürfnisse zu befriedigen.
Auch das Bundesverfassungsgericht weiß um die Auswirkungen des Privateigentums. Es gesteht ihm zunächst zu, sich seinem Interesse folgend gesellschaftlich verantwortungslos verhalten zu dürfen. Erst im Nachhinein wird diese Freiheit eingeschränkt, beispielsweise mit Umweltauflagen oder aber eben mit einer Mietpreisbremse, wenn die Maximierung des Profits das Grundrecht auf Wohnen in Frage stellt. Die lautstarke Gegenwehr der Immobilienwirtschaft, deren Sonderinteressen in den letzten Jahrzehnten viel Raum zur Entfaltung bekommen haben, ist die Reaktion auf diese Einschränkung. Die Polarisierung und Spaltung der Stadtgesellschaften ist vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklungen nur schwer wieder einhegbar. Was also tun?
Was ist im Wohl der Allgemeinheit?
Es ist ein erster richtiger Schritt, die privaten Sonderinteressen zugunsten des Allgemeinwohls einzuschränken, wie es das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zur Mietpreisbremse deutlich gemacht hat. Auch Maßnahmen, wie ein Mietenstopp oder Mietobergrenzen, können der Absicht, größtmögliche Renditen zu erzielen, etwas entgegensetzen, die Auswirkungen abfedern. Das Verhältnis zwischen Privatinteresse und Gemeininteresse, die problematische Logik „zuerst der Schaden, dann die Reparatur“, bleibt aber auch davon unberührt. Deswegen muss die Wohnungsversorgung der privatwirtschaftlichen Logik möglichst weitgehend entzogen werden, um sie in Strukturen demokratischer Selbstverwaltung zu geben, so dass Mieten kostendeckend und nicht mehr renditesteigernd sind.
Die Enteignung großer Immobilienkonzerne, eine Forderung, für die gegenwärtig in Berlin ein Volksbegehren in Prüfung ist, gehört sicher zu den radikalsten Maßnahmen, um Wohnen wieder dem Gebrauchswert statt dem Tauschwert unterzuordnen. Eine solche Enteignung ist übrigens fester Bestandteil der bundesdeutschen Verfassung. Paragraph 14 Absatz 3 beschreibt das ausschließliche Recht des Staates, seine Bürger zu enteignen, und zwar „zum Wohle der Allgemeinheit“ und „durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes“, das „Art und Ausmaß der Entschädigung“ regelt. Von diesem Paragraphen gedeckt sind zum Beispiel Enteignungen von (verkaufsunwilligen) Grundstücks- und Hauseigentümern, wenn dort Straßen angelegt oder Kohlevorkommen abgebaut werden sollen. Aktuell laufen in Deutschland rund 200 Enteignungsverfahren gegen Bauern und Privatleute wegen des geplanten Baus von Straßen. Ob immer mehr Autobahnen „dem Wohle der Allgemeinheit“ dienen, ist allerdings umstritten, ebenso wie der Abbau von umweltschädlicher Kohle.
Dass Wohnen als Grundrecht das Wohl der Allgemeinheit fördert, dürfte dagegen kaum umstritten sein. Enteignung, ebenso wie der Rückkauf ehemals privatisierter Wohnungen, bedeutet erst einmal nur den Wechsel des juristischen Titels, das heißt, die Macht über die Verfügung hat dann die Kommune. Verfügungsmacht ist das eine. Was mit dieser Macht angestellt wird, aber das andere. Und darauf kommt es im Kern an. Diese dann demokratisch kontrollierte Macht müsste gewährleisten, dass Wohnungen künftig dem einzigen Zweck dienen, den Wohnen haben sollte: Menschen selbstverständlich und ohne sie in Existenznöte zu stürzen ein menschenwürdiges Dach über dem Kopf zu geben. Und zwar allen. Auch hierfür hat die Verfassung eine Möglichkeit vorgesehen: Artikel 15 besagt, dass „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden“ können. Was hier angesprochen wird, ist eine Neubestimmung dessen, wie und unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen ein Gut zur Verfügung gestellt wird. Genau eine solche Debatte brauchen wir.
Erschienen in: Blätter für deutsche und internationale Politik. November 2019, Seite 115-120
Fußnoten
[1] Vgl. u.a. Ralf Schönball, In Berlin regiert jetzt die linke Baubrigade, in: „Der Tagesspiegel“, 5.4.2017.
[2] Andrej Holm, Rückkehr der Wohnungsfrage, Bundeszentrale für politische Bildung, www.bpb.de, 9.7.2018.
[3]Statistisches Bundesamt, Bauen und Wohnen. Baugenehmigungen/Baufertigstellungen u.a. nach der Gebäudeart, Wiesbaden 2016.
[4] Vgl. Björn Egner, Max Kayser, Heike Böhler und Katharina Grabietz, Lokale Wohnungspolitik in Deutschland, in: Hans-Böckler-Stiftung, „Working Papers Forschungsförderung“ 2018/100; Investitionsbank Berlin, Wohnungsmarktbericht 2018, www.ibb.de.
[5] Susanne Heeg, Wohnungen als Finanzanlage. Auswirkungen von Responsibilisierung und Finanzialisierung im Bereich des Wohnens, in: „sub\urban“, 1/2013, S. 75-99.
[6] Karl Marx, Kapital I, Marx-Engels-Werke, Bd. 23, S. 198.
[7] Bundesverfassungsgericht, Anträge gegen die „Mietpreisbremse“ erfolglos. Pressemitteilung Nr. 56/2019, www.bundesverfassungsgericht.de, 20.8.2019.
[8] Ausführlicher dazu: Sabine Nuss, Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Die große Wiederaneignung und das vergiftete Versprechen des Privateigentums, Berlin 2019.
[9] Deutsche Bundesbank, Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland: Ergebnisse der Vermögensbefragung 2017, Monatsbericht 4/2019, S. 27.
[10] Donata Riedel, IWF macht Familienunternehmen für Ungleichheit in Deutschland verantwortlich, Handelsblatt, 10.7.2019.
[11] Der österreichische Wohnungswissenschaftler Christian Donner bezeichnet das deutsche System deshalb treffend als eine „Förderung privater Mietwohnungsinvestitionen mit sozialer Zwischennutzung“. Vgl. Christian Donner, Wohnungspolitiken in der Europäischen Union: Theorie und Praxis, Wien 2000.