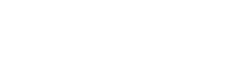25 Jahre Privatisierung der Post – Ein Hörstück
Erschienen bei: Politisches Feuilleton von Deutschlandfunk Kultur vom 31. Januar 2020
Die Privatisierung der Post vor 25 Jahren: Sie sollte einen zum Saurier erklärten Apparat zum modernen Dienstleister machen. Ist das gelungen? Den Preis dafür haben jedenfalls die Beschäftigten bezahlt, kritisiert die Publizistin Sabine Nuss.
25 Jahre ist es her, dass die Privatisierung der einst staatlichen Bundespost zum Abschluss kam. Drei Aktiengesellschaften gingen daraus hervor: Die Deutsche Post, die Deutsche Telekom, die Postbank.
Privatisierungsforscher sagen, die Aufspaltung der Bundespost ab 1989 markierte den Beginn einer viel größer angelegten Umwandlung der öffentlichen Infrastruktur. Dass „Private“ mit ihrer Gewinnorientierung effizienter seien als der Staat, wurde in jener Zeit zum Gemeinplatz.
Post, Bahn, Müll, Bildung, Rente, Gesundheit, alles, was bis dahin zur sogenannten Daseinsvorsorge zählte, sollte einer neuen Handlungslogik gehorchen. Sie lautete im Kern: Kosten sparen, Umsatz steigern, Gewinn maximieren.
Das bekam auch mein Vater zu spüren, der sein ganzes Leben bei der Post zugebracht hatte.
Das letzte Mal, als ich ihn an seinem Arbeitsplatz besuchte, war er Leiter einer Postfiliale im Südwesten Baden-Württembergs. Das war Ende der 1990er-Jahre. Er stand im Eingangsbereich, neben ihm ein Regal mit Werbeartikeln, gelb, mit schwarzem Posthorn: Pralinen, Aufkleber, Kugelschreiber.
Mein Vater begann als Handwerker, wurde dann mit einem Stipendium der Post Ingenieur und stieg in den sogenannten gehobenen Dienst auf. Er arbeitete in der posteigenen Hochbauabteilung, er plante Sanitär- und Heizungsanlagen. Die gelbe Staatspost baute ihre Häuser noch selbst – bis die Privatisierung kam.
Die Gebäude der Post wurden verkauft. Verscherbelt, sagte mein Vater. Er selbst musste umschulen, besuchte Managementseminare. Von da an sollte er mit Produkten wie Sparanlagen oder Riesterrenten Umsatz machen.
Die Filialen standen im Wettbewerb, es gab Rankings und Prämien. „Es geht jetzt nur noch ums Verkaufen“, sagte er manchmal.
Er musste auch Filialen schließen. Im ganzen südbadischen Breisgau war er unterwegs und erklärte den „Postlern“ das Ende ihrer Arbeit: „Das ist nicht einfach, wenn die dann dasitzen und weinen. Was soll man da sagen?“ Dass der Staat zu teuer sei, erklärte er dann. Zu aufgebläht. Ineffizient.
So ein kleines Postamt in einem Schwarzwälder Dörfchen, das kostet. „Jetzt bin ich mal Kapitalist“, sagte er und rechnete vor, „das kostet 5000 DM im Monat, dann machen die nur 1000 DM Umsatz. Die hatten ja nicht immer zu tun.“
Da sei mal die Oma vorbeigekommen, die 20 Mark für den Geburtstag der Enkelin abheben wollte. Das sei alles irgendwann nicht mehr gegangen.
Anfang der 1980er-Jahre gab es in der alten Bundesrepublik noch rund 29.000 eigene Postfilialen und Postämter, 35 Jahre später keine einzige posteigene Filiale mehr, dafür 13.000 private Postagenturen. Tante-Emma-Läden richteten zum Beispiel in ihren Räumen kleine gelbe Verkaufsstellen ein.
Sie bekamen Geld dafür. Nicht viel für den Aufwand, so die Klage. Gegenüber einer eigenen Filiale sparte die Post 60 Prozent an Kosten ein.
Zwischen 1989 und 2006 strich die Deutsche Post AG rund 173.000 Stellen, 46.000 entstanden bei der neuen Konkurrenz. Die Beschäftigungsverhältnisse wurden unsicher, Vollzeitverträge durch Teilzeitverträge ersetzt, Leiharbeiter und Saisonkräfte eingestellt.
Die Einkommensschere klaffte zunehmend auseinander. Hatte der Postminister früher etwa 15-mal so viel wie ein Briefträger auf dem Gehaltszettel, sind es beim Chef der privatisierten Post, Frank Appel, 268-mal so viel.
Das passt ziemlich genau in das Bild des jüngsten Berichts über die zunehmende weltweite soziale Ungleichheit. Seit etwa 1980 wurde in fast allen Ländern der Welt öffentliches Vermögen in gewaltigem Ausmaß in private Hände transferiert. Dort konzentriert es sich.
Privatisierung ist eine Umverteilungsmaschine. Das mag effizient sein. Aber nicht für alle.