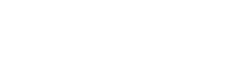Interview mit der Wochenzeitung, Nr. 17 – 27. April 2023
Von Daniela Janser, Anna Jikhareva (Interview)
WOZ: Frau Nuss, was ist eigentlich Eigentum?
Sabine Nuss: Im Alltag betrachten wir Eigentum als Sache: mein Fahrrad, mein Buch, mein Stift, wenn man Glück hat, mein Haus. Will man genauer sein, beschreibt es aber das Recht, andere auszuschliessen – unabhängig von deren Bedarf. Insofern ist Eigentum eine zwischenmenschliche Beziehung. Mein Buch heisst: nicht dein Buch. Wenn ich allein auf einer einsamen Insel bin, ergibt es keinen Sinn, von meiner Palme zu sprechen. Eigentum als gesellschaftliches Verhältnis beschreibt also, in welchen sozialen Hierarchien sich die Menschen in Bezug auf die Aneignung der Natur reproduzieren. Das war historisch höchst unterschiedlich.
Privateigentum im bürgerlichen Sinn hat es also nicht schon immer gegeben. Wie kam es historisch dazu?
Entstanden ist es zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert, einer der Treiber waren die «enclosures», zu Deutsch: Einhegungen. Damals war Land der wichtigste Produktionsfaktor – und die bäuerliche Bevölkerung bewirtschaftete es im Kontext feudaler Abhängigkeitsverhältnisse. Als Leibeigene mussten die Menschen Abgaben an die Landbesitzer, die Grundherren, leisten.
Als die Preise für Wolle stiegen, wurde es für die Grossgrundbesitzer lukrativer, Schafe auf den Flächen weiden zu lassen. Man vertrieb die Leute vom Land – mit verheerenden Folgen: Viele vagabundierten oder verkauften das Einzige, was sie noch hatten – ihre Arbeitskraft –, zu elenden Bedingungen in den Fabriken der wachsenden Städte. Boden und Arbeitskraft wurden so zur Ware: Voraussetzungen für den modernen Kapitalismus und das Privateigentum. Dessen Entstehung war also extrem gewaltsam.
Retrospektiv könnte man sagen, die Menschen wurden aus feudalen Abhängigkeitsverhältnissen befreit. Aber unter welchen Bedingungen? Sie sind ja dann in eine neue Abhängigkeit gerutscht: die der Lohnarbeiter:innen.
Wie wurde Privateigentum denn damals gerechtfertigt?
Prägend war der englische Sozialphilosoph John Locke, der im 17. Jahrhundert lebte. Damals war die Vorstellung noch sehr verbreitet, Gott habe die Erde den Menschen gemeinsam gegeben. Verfügungsgewalt über Land war mit Verpflichtungen verbunden, Gemeindeland üblich. Locke aber rechtfertigte Privateigentum als quasi natürliches Recht. Seine Prämisse war, dass der Körper einem selbst gehöre. Wenn man aber arbeitet, vermischt man seinen Körper mit der Natur. Indem ich einen Apfel pflücke, mache ich diesen zu meinem Eigentum. Eine trickreiche Konstruktion. Aus einem physischen Akt machte Locke ein Naturrecht. Manche sagen, er habe die Bibel des Bürgertums geschrieben.
Ideen verbreiten sich, wenn die Realgeschichte den Boden bereitet. Lockes Naturrechtsbegründung war natürlich ideal für die Rechtfertigung der Enclosures. Wir finden bei ihm übrigens bereits die «Anreiztheorie des Eigentums»: Wenn die Menschen die Früchte ihrer Arbeit ernten können, sind sie produktiver. Das führt dann insgesamt zu Wachstum, wovon dann alle etwas hätten. Zwar hat sich der Kapitalismus seit Locke enorm gewandelt, aber diese Legitimationsideologie gilt bis heute.
Gab es Kritik oder Widerstand gegen diese Entwicklungen in jener Zeit?
Jean-Jacques Rousseau kritisierte eine Generation nach Locke die herrschende Ungleichheit, als deren Ursache er die Herausbildung von Eigentum sah. Wer denkt nicht an die Enclosures bei seinem berühmten Zitat vom Ersten, der ein Stück Land eingezäunt hat und dann sagte, es sei seins, und der dann «einfältige» Leute fand, die das glaubten? Dieser sei der wahre Begründer der bürgerlichen Gesellschaft, so Rousseau.
Soziale Bewegungen, die sich gegen die Einhegungen auflehnten, gab es immer wieder. Auch Vagabundinnen und Räuber werden mitunter als Sozialrebell:innen romantisiert, man darf aber nicht vergessen, aus welcher Not heraus sie zu diesen Praktiken griffen. Heute finden wir es völlig normal, dass die grosse Mehrheit weder über Land noch über Produktionsmittel verfügt.
Heute erscheint uns Privateigentum also als selbstverständlich. Wie sind wir an diesen Punkt gekommen?
Die Leute haben geschluckt, dass Arbeit Eigentum begründet. Sie haben die Anrufungen des Privateigentums verinnerlicht: Jeder ist seines Glückes Schmied. Ohne Fleiss kein Preis. Was heisst das in der Umkehrung? Menschen, die nichts haben, waren wohl nicht fleissig. Die sozialpsychologische Kehrseite ist Selbstabwertung, weil man es «zu nichts gebracht» hat. Und der Schein, dass Arbeit und Eigentum irgendwie zusammenhängen, kommt daher, dass ja tatsächlich ein Lohn für Arbeit bezahlt wird und dass ich damit etwas tausche, worin ebenfalls Arbeit steckt: Geld gegen Ware. Konkurrenz lernen wir schon in der Schule, die uns für den Arbeitsmarkt selektiert. Und auch in die Tauschpraxis wachsen wir von Kindesbeinen an rein. Wir können uns gar keine Welt vorstellen, in der wir den Schokoriegel ohne Preis im Supermarkt vorfinden würden.
Aber es gibt doch Kritik an den Eigentumsverhältnissen?
Klar. Aber das zugrunde liegende Machtverhältnis bleibt unangetastet: Verfügt jemand exklusiv über Produktionsmittel, kann er Menschen, die nichts haben ausser ihrer Arbeitskraft, ausbeuten, indem er sie für sich arbeiten lässt. Die Leute prangern aber nur Ungleichheit, schlechte Arbeitsbedingungen oder niedrige Löhne an. Sie wünschen sich also Mächtige, die nett zu ihnen sind, keine Aufhebung dieser Macht. Das wird ihnen auch nahegelegt, weil sie freie, gleiche Rechtssubjekte sind, die mit einem Arbeitgeber einen Vertrag abschliessen können.
Es scheint, als wäre diese persönliche Freiheit die grosse Errungenschaft der bürgerlichen Gesellschaft. Tatsächlich ist es aber bloss die Freiheit, sich einem anderen per Vertrag unterzuordnen. Dieser Schritt war historisch notwendig. Freiheit und Gleichheit waren die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt wieder eine Verbindung zwischen untergeordneten und besitzenden Klassen gab: Weil es keine Leibeigenschaft mehr gab, hat man das neu über Verträge geregelt.
Vom Tellerwäscher zum Millionär: Diese Vorstellung ist beliebt, aber bekanntlich falsch. Wie kommt man aus diesem Denken raus?
Ja, die Erfahrung bricht sich oft am Dogma, dass Arbeit Eigentum begründe. Wer würde ernsthaft sagen, dass jene mit wenig Eigentum faul waren? Wir wissen, dass sich die Menschen in der Pflege kaputt arbeiten. Dass sie wenig verdienen, liegt also sicher nicht daran, dass sie nicht gearbeitet haben. Das ist doch die erste Widerlegung der These. De facto eignet sich eine Minderheit die Arbeit der Mehrheit an. Letztere verfügt bloss über «Konsument:innensouveränität», sie kann im Supermarkt entscheiden, was sie kauft. In Arbeitskämpfen für Umverteilung müsste man dieses Machtverhältnis mitreflektieren und für Demokratie in den Produktionsverhältnissen streiten.
Wäre die Enteignung ein Rückgängigmachen dieser vermeintlichen Selbstverständlichkeiten?
In meinem Buch «Keine Enteignung ist auch keine Lösung» spreche ich von drei Bedeutungen des Begriffs «Enteignung». Die erste ist die juristische. Im deutschen Grundgesetz ist das Recht des bürgerlichen Staates zur Enteignung verankert – wenn der Staat dies für das öffentliche Wohl macht und die enteignete Person entschädigt wird. 2019 gab es etwa 200 Enteignungsverfahren, vorwiegend für Strassen oder Kohleabbau. Diese Enteignung wird als legitim erachtet. In Berlin ist die Enteignungsdebatte extrem aufgeladen, die Konservativen behaupten, Enteignung sei Gulag und Stalinismus. Aber wenn der Staat für Kohleabbau oder Autobahnen enteignet, hört man nichts.
Und die anderen Bedeutungen?
Die zweite ist ein moralischer Kampfbegriff ohne juristischen Inhalt. Weil er derart polarisiert, eignet er sich hervorragend für alle Seiten. Sahra Wagenknecht meinte mal, die Lohnkürzungen der letzten Jahre seien eine Enteignung der Lohnabhängigen. Doch juristisch gesehen ist das keine Enteignung. Und die Berliner Kampagne «Deutsche Wohnen & Co enteignen», die im September 2021 in einer Volksabstimmung abgesegnet wurde, spricht von der Enteignung der Immobilienkonzerne. Dabei bezieht sie sich gar nicht auf den Enteignungsartikel im Grundgesetz, sondern auf Artikel 15, der Vergesellschaftung definiert. Dessen Einführung wurde 1949 von der Sozialdemokratie erkämpft, als nach dem Faschismus das Grundgesetz neu ausgehandelt wurde. Einer der Gründe dafür war, dass man die Verfassung nicht auf eine bestimmte Wirtschaftsform festlegen wollte.
Artikel 15 scheint ein deutsches Spezifikum zu sein. Gibt es ähnliche Beispiele in anderen Ländern?
Eine Form von Sozialbindung von Eigentum existiert eigentlich überall: Sobald du Eigentum in der Verfassung verankerst, musst du eine Einschränkungsmöglichkeit für den Staat vorsehen – der berühmte Spruch «Eigentum verpflichtet». Hätte der Staat keine Eingriffsmöglichkeiten, würde das Privateigentum frei flottieren. Das wäre gefährlich für den Staat und das Kapital selbst – die Wahrscheinlichkeit, dass die Wachstumslogik des Privateigentums irgendwann seine eigenen Grundlagen zerstört, ist zu gross.
Die dritte Bedeutung von Enteignung ist historisch, sie bezieht sich auf die Enclosures. Diese rückgängig zu machen, würde heissen, die Verfügungsgewalt über die Aneignung der Natur wieder in die Hände der Mehrheit zurückzugeben, man könnte auch «Demokratisierung der Wirtschaft» dazu sagen.
Aktuell wird der Enteignungsbegriff immer öfter von links ins Spiel gebracht. Wie erklären Sie sich das?
Weil er mobilisiert. Man darf zwei zentrale Entwicklungen der letzten Jahrzehnte nicht vergessen: das drastische Öffnen der Schere zwischen Arm und Reich – nicht nur im globalen Massstab, sondern auch in den einzelnen Ländern. Das liegt nicht zuletzt an der Dominanz von Privateigentum in den letzten vierzig Jahren. Der französische Ökonom Thomas Piketty hat hergeleitet, dass die Privatisierungsoffensiven eine der Hauptursachen für die wachsende soziale Ungleichheit seien.
Die zweite Entwicklung ist die Ausbeutung der Natur mit ihren drastischen Folgen. Beides bringt die Leute auf die Barrikaden. Im Kleinen kann ich das in Berlin beobachten: Die Mieter:innen von Deutsche Wohnen sind richtig sauer. Sie sagen: «Warum werft ihr uns Enteignung vor? Die haben doch uns enteignet die letzten Jahre mit ihren Mieterhöhungen.» Der Begriff «Enteignung» gibt der Wut ein Ventil. Es hat in Berlin ja auch Erfolg gezeigt. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass man damit die Leute abschreckt.
In Ihrem Buch schreiben Sie, Enteignungen innerhalb der Marktlogik brächten nichts. Wie kommt man aus dem Teufelskreis des Marktes heraus?
Beziehen wir uns als Linke auf Enteignung im juristischen Sinn, gehen wir das Risiko ein, dass zwar der Eigentümer wechselt, aber nicht die Profitlogik. Zuweilen stellt ja auch der Staat selbst etwas in der Logik des Privateigentums zur Verfügung – bei der Deutschen Bahn ist der Anteilseigner staatlich, trotzdem geht es um Gewinnerwirtschaftung und Sparzwänge.
Wir haben sicher mehr gewonnen, wenn wir begreifen, dass der Eigentumswechsel ein Wechsel des Unternehmenszwecks sein sollte, nicht in erster Linie ein Wechsel des Trägers. Im erwähnten Artikel 15 etwa wird gesagt, dass ein Unternehmen, das vergesellschaftet wird, gemeinnützig agieren muss, statt weiter die Profitlogik zu verfolgen. Deshalb ist Vergesellschaftung politisch interessanter als Enteignung.
Kam Artikel 15 denn schon einmal zur Anwendung?
Noch nie. Die Liberalen versuchen mitunter, ihn aus dem Grundgesetz zu streichen – mit dem Argument, er sei ein historischer Anachronismus. Zum Glück haben sie sich bisher nicht durchsetzen können. In Berlin müssen sich die Expert:innen in einer eigens dazu vom Senat geschaffenen Kommission nun erstmals mit dem Artikel auseinandersetzen, diskutieren, was das überhaupt ist, Vergesellschaftung. Am Ende wird es vermutlich zum Verfassungsgericht gehen, das werden spannende Debatten, der ehemalige Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts freut sich übrigens auch. Er meinte jüngst, in Artikel 15, da sei Musik drin. Ein spannender Präzedenzfall.
Was würde Vergesellschaftung denn aus Ihrer Sicht heissen?
Heute produzieren die Unternehmen für einen anonymen Markt. Sie stehen in Konkurrenz zueinander und verfolgen einzig das Ziel, dass das von ihnen vorgeschossene Kapital vermehrt zurückkommt. Das führt zum Wettlauf nach unten auf Kosten von menschlicher Arbeitskraft und Natur. Lebten wir aber eine kooperative Vergesellschaftung, würde die Gesellschaft demokratisch darüber entscheiden, wie die Produktionsmittel – Maschinen, Land, Computer und Bürogebäude – eingesetzt werden, und zwar bevor etwas produziert wird. Damit hätten wir auch die Verzichtsdebatte umgangen: Wenn wir vorher entscheiden, was wir brauchen, kommt vieles gar nicht erst in die Regale. Wenn ich das produzierte Fleisch schon im Kühlregal liegen sehe und es nicht kaufen soll, kommt eher ein Verzichtsgefühl auf, als wenn ich in die Entscheidung eingebunden bin.
Und welche Rolle käme dabei dem Staat zu?
«Der Staat», das ist eine sehr abstrakte Perspektive. In der Praxis verdichten sich im Staatsapparat höchst unterschiedliche, auch widersprüchliche Interessen. Bleiben wir aber auf der abstrakten Ebene, ist der Staat auf Wirtschaftswachstum angewiesen, da er daraus seine Steuern generiert. Wenn sich nun Unternehmen flächendeckend der Profitmaximierung entziehen und miteinander kooperieren würden, wäre das herrschende Wachstumsparadigma grundsätzlich hinterfragt und damit die Einkommensquelle des Staates. Die Transformation einer profitorientierten und kompetitiven Wirtschaftsform hin zu einer bedürfnisorientierten und kooperativen wäre perspektivisch womöglich mit der Aufhebung des modernen Staates verbunden.
Eine revolutionäre Entwicklung.
Zumindest langfristig betrachtet. Das ganze bürgerliche Recht ist ja auf Wettbewerb, Privateigentum und Gewinnerzielung ausgerichtet. Schauen Sie sich mal das Kartellrecht an, es dient dazu, Konkurrenzstrukturen aufrechtzuerhalten. Die Repräsentanten des Staates sind sich der toxischen Privateigentumslogik nicht bewusst, die verhindert, dass Realpolitik im Sinne aller handelt. Da fehlt es an kollektiver Selbstreflexion, an Durchdringung der Welt. Andernfalls müssen wir davon ausgehen, dass sie es erstrebenswert finden, sich in Konkurrenz zu anderen Nationen zu setzen, in einem Spannungsverhältnis, das sich nicht selten in gewaltsamen Auseinandersetzungen entlädt. Dennoch spreche ich in meinem Buch von einer möglichen Komplizenschaft mit dem Staat: Als Hebel können sich soziale Bewegungen auf die Sozialbindung des Eigentums berufen.
Und die Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen wäre ein Schritt in diese Richtung?
Auf jeden Fall. In Berlin hat die Kampagne sich überlegt, wie die Wohnungen verwaltet würden, wenn sie nicht mehr unter der Ägide der Konzerne stünden: Sie wollen eine Anstalt des öffentlichen Rechts, in der die Mieter:innen, die Verwaltung, der Senat und die Stadtgesellschaft gemeinsam über die Nutzung bestimmen, also eine Struktur jenseits staatlicher Trägerschaft. Man könnte sich verständigen, dass man mehr Miete zahlt und mit dem Überschuss neue Wohnungen baut.
Weil wir dann immer noch im Kapitalismus leben, wird das immer mit Widersprüchen behaftet sein. Wir werden keine endgültigen Grosslösungen finden, das ist eine Illusion. Aber es können Räume entstehen, in denen wir lernen, was geht und was nicht. Solange man das als Praxis versteht und nicht schon als Lösung, kann es die Chance bieten, auch auf andere Bereiche auszustrahlen.
Ein Plädoyer für die kleinen Schritte also: dass man die kooperative Ökonomie auch im kapitalistischen System umsetzt, um es dann von innen her zu infizieren.
Ja. Insellösungen existieren ja jetzt schon: als Kooperativen organisierte Supermärkte etwa, die jedoch oft auf Selbstausbeutung hinauslaufen und meist von hohem Idealismus getragen sind. Diese Widersprüche haben ja auch mit den herrschenden Verhältnissen zu tun: Kleine Ladenkollektive stehen mit den Preisen ihrer Produkte in Konkurrenz mit grossen Bioketten und sparen deshalb bei den Löhnen. Man darf sich da keinen Illusionen hingeben.
Und wie schafft man bei der Wohnfrage eine Motivation jenseits der Eigentumslogik?
Ich habe mal in einem Wohnprojekt gelebt, mit unserer Miete konnte sich niemand bereichern. Das hat uns ermöglicht, die Verwaltung selbst zu organisieren, zu entscheiden, was wir bauen oder instand setzen, wie viel wir zahlen. Eine grosse Freiheit! Der Nachteil war, dass man oft keine Lust auf die Plenen hatte. Selbstverwaltung ist anstrengend. Wären nicht alle im Hausprojekt damit beschäftigt, Vollzeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, wäre das entspannter.
Die Probleme alternativer Eigentumsformen haben aus meiner Sicht nichts mit mangelnder Motivation zu tun, etwa weil dort Anreize zur individuellen Bereicherung fehlen würden. Das ist vielfältig widerlegbar. Nehmen wir etwa die Ursprünge von Open-Source-Software: Viele Menschen haben sich global zusammengetan und auf freiwilliger Basis ein Produkt entwickelt. Ihre Motivation lag nicht im Profit, sondern es war das Produkt, das interessierte, man wollte gemeinsam etwas Besseres als Microsoft haben. Oder wenn man etwas mit Freund:innen organisiert oder bei einem Klimacamp, wo Tausende gemeinsam etwas auf die Beine stellen jenseits von Gewinnmaximierung.
Demokratische und bedürfnisorientierte Wirtschaftsformen brauchen passende Bedingungen, und das sind in erster Linie Zeit und soziale Sicherheit. Diese müssen wir dem Kapitalismus abtrotzen.